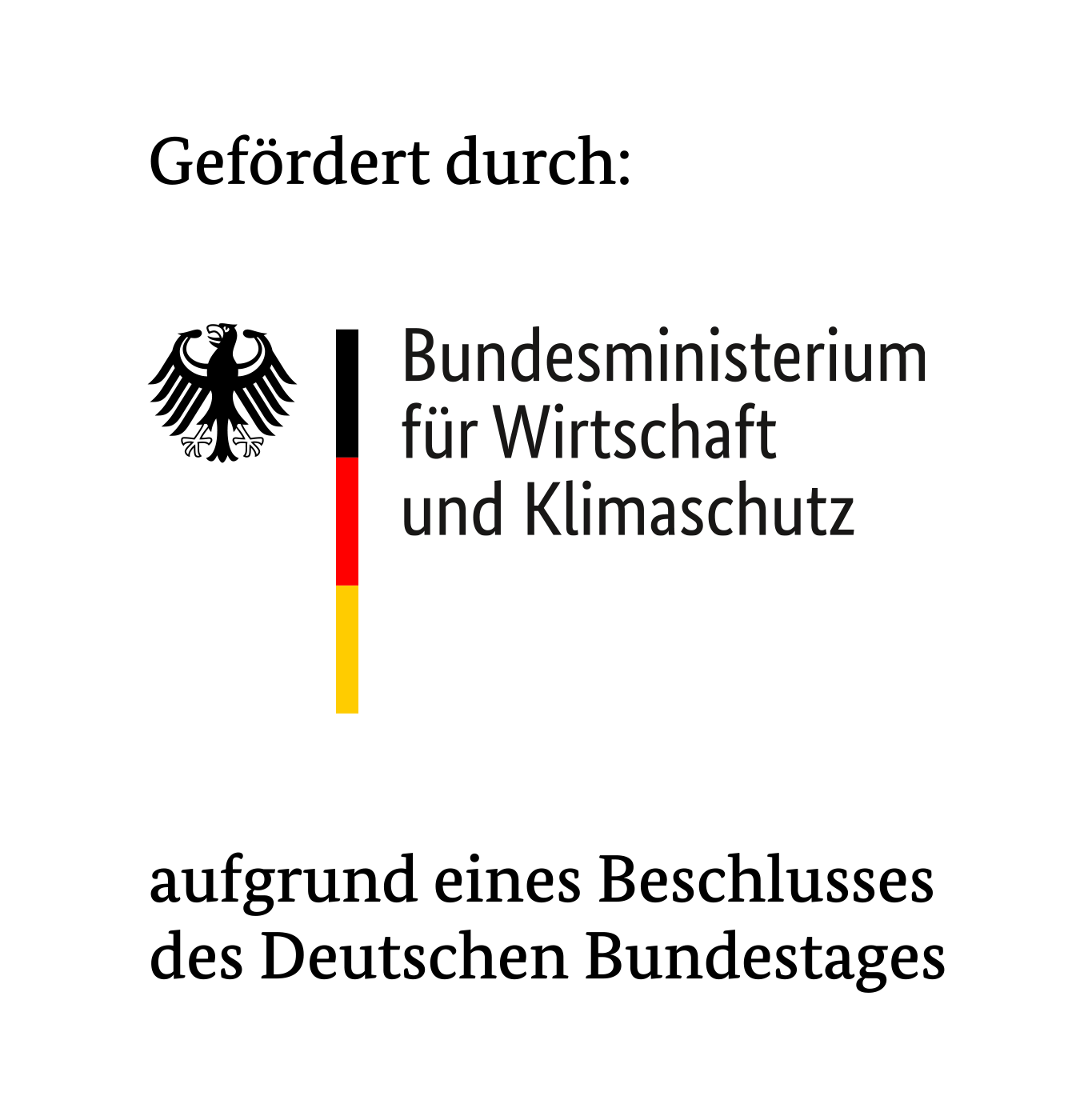Vorhaben-Nr. 22948 BG | EFDS Nr. IGF-20/11
Laufzeit: 01.07.2023 – 30.06.2025
Forschungseinrichtung:
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Chenitz
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Braunschweig
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden
Abstract
PEM-Brennstoffzellen bieten enormes Potential zur Senkung der Treibhausgasemission. Ihr derzeitiger Einsatz wird allerdings durch eine nicht wirtschaftliche Großserien Produktion limitiert. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung und Erprobung neuer Fertigungsrouten metallischer BPP. Dies umfasst die Kombination von zwei verschiedenen Beschichtungsansätzen und Umformverfahren:
Lösungsansatz 1: Hier werden funktionale Kohlenstoff-Schichtsysteme hergestellt die auch nach dem Umformen ihre hohe elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit beibehalten sollen. Ein Vergleich zwischen ARC-Verdampfung und dem Magnetronsputtern wird hier durchgeführt. Ebenso wird das HIPIMS berücksichtig.
Lösungsansatz 2: In diesem neuen Herstellungsweg der BPP wird entgegen dem aktuellen Stand der Technik eine metallisch vorbeschichtete Platte nach der Umformung durch eine Plasmadiffusionsbehandlung funktionalisiert, um Defekte in Folge der Umformung zu minimieren und Korrosionsinitiierungsorte zu vermieden.
Lösungsansätze für die Umformung: Für die Umformung sollen jeweils drei verschiedene Verfahren angewendet werden (Hohlprägen, -prägewalzen, Hydroforming). Einbindung von Lösungsansätzen aus dem PA: Dem teilnehmendem PA und insbesondere den beteiligten KMU wird die Möglichkeit gegeben eigene Beschichtungen zu applizieren und analysieren bzw. bewerten zu lassen, um den eigenen Stand der Technik mit dem der Forschung zu vergleichen und sich einen technologischen Vorsprung zu sichern. Der unmittelbare Nutzen der Forschungsergebnisse für die KMU ergibt sich vor allem durch das gesteigerte Know-how bezüglich der Eigenschaften und Grenzen der untersuchten Beschichtungs- und Umformverfahren und deren Auswirkung auf die Einsatzbedingungen der BPP, welches gemeinsam mit beteiligten Großunternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen erarbeitet wird. Durch dieses Wissen sichern sich die beteiligten Unternehmen entsprechende Wettbewerbsvorteile.